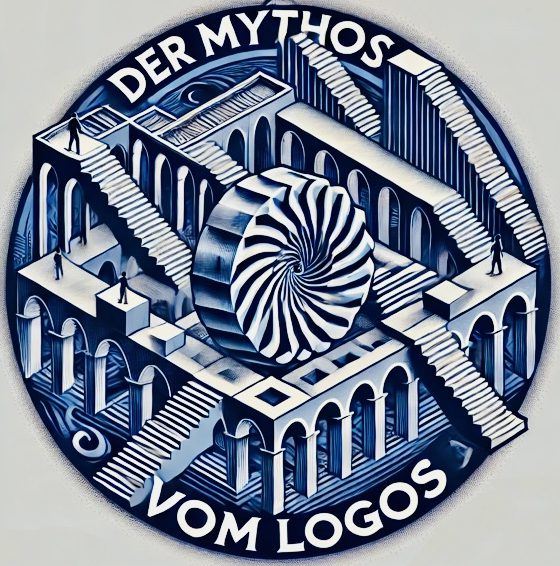Die Wingspread-Erklärung (Januar 1998)
Die Teilnehmer des Workshops kamen zu folgendem Konsens:
Wir sind uns über Folgendes sicher:
Zahlreiche vom Menschen hergestellte Chemikalien, die in die Umwelt freigesetzt werden, sowie einige wenige natürliche Chemikalien haben das Potenzial, das Hormonsystem von Tieren, einschließlich des Menschen, zu stören. Dazu gehören die persistenten, bioakkumulierbaren, halogenorganischen Verbindungen, zu denen einige Pestizide (Fungizide, Herbizide und Insektizide) und Industriechemikalien, andere synthetische Produkte und einige Metalle gehören.
Viele Wildtierpopulationen sind bereits von diesen Verbindungen betroffen. Zu den Auswirkungen gehören Schilddrüsenfehlfunktionen bei Vögeln und Fischen, eine geringere Fruchtbarkeit bei Vögeln, Fischen, Schalentieren und Säugetieren, ein geringerer Schlupferfolg bei Vögeln, Fischen und Schildkröten, grobe Missbildungen bei Vögeln, Fischen und Säugetieren, Stoffwechselstörungen bei Vögeln, Fischen und Säugetieren, Verhaltensauffälligkeiten bei Vögeln, Entmannung und Verweiblichung von männlichen Fischen, Vögeln und Säugetieren, Entweiblichung und Vermännlichung von weiblichen Fischen und Vögeln sowie ein geschwächtes Immunsystem bei Vögeln und Säugetieren.
Die Wirkungsmuster variieren von Art zu Art und von Verbindung zu Verbindung.
Dennoch können vier allgemeine Feststellungen getroffen werden:
- Die besorgniserregenden Chemikalien können ganz andere Auswirkungen auf den Embryo, den Fötus oder den perinatalen Organismus haben als auf den Erwachsenen;
- Die Auswirkungen zeigen sich meist bei den Nachkommen und nicht bei den exponierten Eltern;
- Der Zeitpunkt der Exposition im sich entwickelnden Organismus ist entscheidend für seinen Charakter und sein zukünftiges Potenzial; und
- Obwohl eine kritische Exposition während der Embryonalentwicklung auftritt, können offensichtliche Manifestationen erst in der Reifezeit auftreten.
Laborstudien bestätigen die im Feld beobachtete abnorme sexuelle Entwicklung und liefern biologische Mechanismen zur Erklärung der Beobachtungen in der freien Natur.
Auch der Mensch ist von derartigen Verbindungen betroffen. Die Wirkung von DES (Diethylstilbestrol), einem synthetischen Therapeutikum, ist wie bei vielen der oben genannten Verbindungen östrogen. Töchter von Müttern, die DES eingenommen haben, leiden heute unter einer erhöhten Rate an vaginalen Adenokarzinomen, verschiedenen Anomalien des Genitaltrakts, abnormalen Schwangerschaften und einigen Veränderungen der Immunreaktionen. Sowohl Söhne als auch Töchter, die in utero exponiert wurden, leiden unter angeborenen Anomalien ihres Fortpflanzungssystems und einer verminderten Fruchtbarkeit. Die Auswirkungen, die bei in utero DES-exponierten Menschen beobachtet wurden, entsprechen denen, die bei kontaminierten Wildtieren und Labortieren gefunden wurden, was darauf hindeutet, dass der Mensch den gleichen Umweltrisiken ausgesetzt sein könnte wie Wildtiere.
Wir schätzen das mit Zuversicht:
Einige der Entwicklungsstörungen, über die heute beim Menschen berichtet wird, treten auch bei erwachsenen Nachkommen von Eltern auf, die synthetischen Hormonstörungen (Agonisten und Antagonisten) ausgesetzt sind, die in der Umwelt freigesetzt werden. Die Konzentrationen einer Reihe von synthetischen Sexualhormon-Agonisten und -Antagonisten, die heute in der menschlichen Bevölkerung in den USA gemessen werden, liegen weit innerhalb des Bereichs und der Dosierungen, bei denen Auswirkungen in Wildtierpopulationen beobachtet werden. Tatsächlich werden experimentelle Ergebnisse am unteren Ende der derzeitigen Umweltkonzentrationen beobachtet.
Wenn die Umweltbelastung durch synthetische Hormonstörungen nicht eingedämmt und kontrolliert wird, sind weitreichende Funktionsstörungen in der Bevölkerung möglich. Das Ausmaß und die potenzielle Gefahr für wild lebende Tiere und Menschen sind groß, da die Wahrscheinlichkeit einer wiederholten und/oder ständigen Exposition gegenüber zahlreichen synthetischen Chemikalien, die bekanntermaßen das Hormonsystem stören, hoch ist.
In dem Maße, wie die Aufmerksamkeit auf dieses Problem gelenkt wird, werden weitere Parallelen in der Forschung an Wildtieren, im Labor und beim Menschen aufgedeckt werden.
Aktuelle Modelle sagen voraus:
Die Mechanismen, durch die diese Verbindungen ihre Wirkung entfalten, sind unterschiedlich, aber sie haben die folgenden allgemeinen Eigenschaften
Nachahmung der Wirkungen natürlicher Hormone durch Erkennung ihrer Bindungsstellen; die Wirkung dieser Hormone antagonisieren, indem sie ihre Wechselwirkung mit ihren physiologischen Bindungsstellen blockieren; sie reagieren direkt und indirekt mit dem betreffenden Hormon;durch Veränderung des natürlichen Synthesemusters der Hormone; oder Veränderung der Hormonrezeptorwerte.
Sowohl exogene (von außen zugeführte) als auch endogene (von innen zugeführte) Androgene (männliche Hormone) und Östrogene (weibliche Hormone) können die Entwicklung der Gehirnfunktion verändern.
Jede Störung des endokrinen Systems eines sich entwickelnden Organismus kann die Entwicklung dieses Organismus verändern: In der Regel sind diese Auswirkungen irreversibel. So werden beispielsweise viele geschlechtsspezifische Merkmale während eines Zeitfensters in den frühen Entwicklungsstadien hormonell bestimmt und können durch kleine Veränderungen im Hormonhaushalt beeinflusst werden. Es gibt Hinweise darauf, dass einmal eingeprägte geschlechtsbezogene Merkmale unumkehrbar sein können.
Die bei wild lebenden Tieren festgestellten Auswirkungen auf die Fortpflanzung sollten auch für Menschen von Bedeutung sein, die von denselben Ressourcen, z. B. kontaminiertem Fisch, abhängig sind. Speisefisch ist ein wichtiger Expositionspfad für Vögel. Das Vogelmodell für chlororganische endokrine Störungen ist das bisher am besten beschriebene. Aufgrund der Ähnlichkeiten in der Entwicklung des Hormonsystems von Vögeln und Säugetieren ist es auch ein Beleg für die Verbindung zwischen Wildtieren und Menschen.
Unsere Vorhersagen sind mit vielen Unsicherheiten behaftet, denn:
Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen der Exposition auf den Menschen sind nicht genau bekannt. Es liegen nur wenige Informationen über die Verteilung dieser Schadstoffe im Menschen vor, insbesondere Daten über die Schadstoffkonzentrationen in Embryonen. Hinzu kommen das Fehlen messbarer Endpunkte (biologische Marker für Exposition und Wirkung) und das Fehlen von Studien zur Mehrgenerationenexposition, die die Umgebungskonzentrationen simulieren.
Während es angemessene quantitative Daten über die Verringerung des Fortpflanzungserfolgs bei Wildtieren gibt, sind die Daten über Verhaltensänderungen weniger zuverlässig. Die Erkenntnisse reichen jedoch aus, um sofortige Anstrengungen zur Schließung dieser Wissenslücken zu fordern.
Die Potenz vieler synthetischer Östrogene im Vergleich zu natürlichen Östrogenen ist nicht bekannt. Dies ist wichtig, weil die heutigen Blutkonzentrationen einiger der bedenklichen Verbindungen höher sind als die von intern hergestellten Östrogenen.
Das ist unser Urteil:
Die Prüfung von Produkten zu Zulassungszwecken sollte auf die hormonelle Aktivität in vivo ausgeweitet werden. Für diesen Aspekt der Prüfung gibt es keinen Ersatz für Tierversuche.
Screening-Assays für Androgenität und Östrogenität sind für diejenigen Verbindungen verfügbar, die direkte hormonelle Wirkungen haben. Die Vorschriften sollten ein Screening aller neuen Produkte und Nebenprodukte auf hormonelle Aktivität vorschreiben. Fällt der Test positiv aus, sollten weitere Tests auf funktionelle Teratogenität (Funktionsverluste und nicht offensichtliche grobe Geburtsfehler) unter Verwendung von Mehrgenerationenstudien vorgeschrieben werden. Dies sollte auch für alle persistenten, bioakkumulierbaren Produkte gelten, die in der Vergangenheit freigesetzt wurden.
Es ist dringend erforderlich, die reproduktiven Auswirkungen und die funktionelle Teratogenität bei der Bewertung von Gesundheitsrisiken in den Vordergrund zu rücken. Das Krebs-Paradigma ist unzureichend, da Chemikalien neben Krebs auch andere schwerwiegende gesundheitliche Auswirkungen haben können.
Wir brauchen eine umfassendere Bestandsaufnahme dieser Verbindungen, die in den Handel gelangen und schließlich in die Umwelt freigesetzt werden. Diese Informationen müssen leichter zugänglich gemacht werden. Informationen wie diese bieten die Möglichkeit, die Exposition durch Eindämmung und Manipulation der Nahrungsketten zu verringern. Anstatt Schadstoffe im Wasser, in der Luft und im Boden getrennt zu regulieren, sollten sich die Regulierungsbehörden auf das Ökosystem als Ganzes konzentrieren.
Das Verbot der Herstellung und Verwendung von persistenten Chemikalien hat das Problem der Exposition nicht gelöst. Es sind neue Ansätze erforderlich, um die Belastung durch synthetische Chemikalien, die sich bereits in der Umwelt befinden, zu verringern und die Freisetzung neuer Produkte mit ähnlichen Eigenschaften zu verhindern.
Die Auswirkungen auf wild lebende Tiere und Labortiere infolge der Exposition gegenüber diesen Schadstoffen sind so tiefgreifend und heimtückisch, dass eine umfassende Forschungsinitiative für den Menschen durchgeführt werden muss.
Die allgemeine Unkenntnis der Wissenschaft und des öffentlichen Gesundheitswesens über das Vorhandensein hormonell aktiver Umweltchemikalien, funktionelle Teratogenität und das Konzept der transgenerationalen Exposition muss beseitigt werden. Da funktionelle Defizite bei der Geburt nicht sichtbar sind und sich möglicherweise erst im Erwachsenenalter vollständig manifestieren, werden sie häufig von Ärzten, Eltern und Behörden übersehen, und die Ursache wird nie ermittelt.
Wir müssen unsere Vorhersagefähigkeit verbessern:
Es ist mehr Grundlagenforschung auf dem Gebiet der Entwicklungsbiologie hormonell reagierender Organe erforderlich. So muss zum Beispiel die Menge an spezifischen endogenen Hormonen ermittelt werden, die erforderlich ist, um eine normale Reaktion hervorzurufen. Es werden spezifische biologische Marker für die normale Entwicklung pro Spezies, Organ und Entwicklungsstadium benötigt. Mit diesen Informationen können die Werte ermittelt werden, die pathologische Veränderungen hervorrufen.
Integrierte kooperative Forschung ist erforderlich, um sowohl Wildtier- als auch Labormodelle für die Extrapolation von Risiken auf den Menschen zu entwickeln.
Die Auswahl einer Sentinel-Spezies auf jeder trophischen Ebene in einem Ökosystem ist notwendig, um funktionelle Defizite zu beobachten und gleichzeitig die Dynamik einer Substanz zu beschreiben, die sich durch das System bewegt.
Es werden messbare Endpunkte (biologische Marker) als Ergebnis der Exposition gegenüber exogenen Umwelthormonen benötigt, die eine Reihe von Auswirkungen auf molekularer, zellulärer, organismischer und Populationsebene umfassen. Molekulare und zelluläre Marker sind wichtig für die frühzeitige Überwachung von Funktionsstörungen. Normale Spiegel und Muster von Isoenzymen und Hormonen sollten ermittelt werden.
Bei Säugetieren sind Expositionsabschätzungen erforderlich, die auf der Körperbelastung durch Chemikalien basieren, die die Konzentration einer Chemikalie in einer Eizelle (Ovum) beschreiben, die auf eine Chemikaliendosis für den Embryo, den Fötus, das Neugeborene und den Erwachsenen extrapoliert werden kann. Es werden Gefährdungsbeurteilungen benötigt, die im Labor wiederholen, was in der Praxis beobachtet wird. Anschließend muss im Labor ein Dosisgradient für bestimmte Reaktionen ermittelt und dann mit den Expositionswerten in Wildtierpopulationen verglichen werden.
Zur Erklärung des jährlichen Zustroms von wandernden Arten in Gebiete mit bekannter Verschmutzung, die trotz der relativen Anfälligkeit ihrer Nachkommen stabile Populationen zu haben scheinen, ist eine anschaulichere Feldforschung erforderlich.
Eine Neubewertung der in utero DES-exponierten Population ist aus einer Reihe von Gründen erforderlich. Erstens könnten die Ergebnisse der ursprünglichen DES-Studien durch die weit verbreitete Exposition gegenüber anderen synthetischen endokrinen Substanzen verfälscht worden sein, da die unregulierte, großvolumige Freisetzung synthetischer Chemikalien mit der Verwendung von DES zusammenfällt. Zweitens kann die Exposition gegenüber einem Hormon während des fötalen Lebens die Empfindlichkeit gegenüber diesem Hormon im späteren Leben erhöhen. So erreicht die erste Welle von Personen, die DES in utero ausgesetzt waren, gerade das Alter, in dem verschiedene Krebsarten (Vaginal-, Endometrium-, Brust- und Prostatakrebs) auftreten können, wenn die Personen aufgrund der perinatalen Exposition gegenüber östrogenähnlichen Verbindungen einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Es muss ein Schwellenwert für die schädlichen Wirkungen von DES festgelegt werden. Selbst die niedrigste registrierte Dosis hat zu einem vaginalen Adenokarzinom geführt. Die DES-Exposition fötaler Menschen kann das Modell mit den schwersten Auswirkungen bei der Untersuchung der weniger starken Auswirkungen von Umweltöstrogenen darstellen. Daher werden die biologischen Endpunkte, die bei in utero DES-exponierten Nachkommen bestimmt wurden, die Untersuchung beim Menschen nach einer möglichen Umweltexposition leiten.
Die Auswirkungen endokriner Disruptoren auf länger lebende Menschen sind möglicherweise nicht so leicht zu erkennen wie bei kürzer lebenden Labor- oder Wildtierarten. Daher werden Methoden zur Früherkennung benötigt, um festzustellen, ob die Fortpflanzungsfähigkeit des Menschen nachlässt. Dies ist sowohl auf individueller als auch auf Bevölkerungsebene wichtig, da Unfruchtbarkeit ein Thema ist, das große Sorgen bereitet und psychologische und wirtschaftliche Auswirkungen hat. Inzwischen gibt es Methoden zur Bestimmung der Fruchtbarkeitsrate beim Menschen. Bei den neuen Methoden sollten verstärkt Untersuchungen der Leberenzymaktivität, Spermienzählungen, Analysen von Entwicklungsanomalien und die Untersuchung histopathologischer Läsionen eingesetzt werden. Gleichzeitig sollten mehr und bessere Biomarker für die soziale und verhaltensmäßige Entwicklung, die Verwendung von Mehrgenerationenstudien von Individuen und ihren Nachkommen sowie generationsübergreifende chemische Analysen von reproduktiven Geweben und Produkten, einschließlich Muttermilch, eingesetzt werden.
An dieser Wingspread-Konferenz nahmen teil:
Dr. Howard A. Bern, Professor für Integrative Biologie (emeritiert) und Forschungsendokrinologe, Universität von Kalifornien-Berkeley
Dr. Phyllis Blair, Professorin für Immunologie, Universität von Kalifornien-Berkeley
Sophie Brasseur, Meeresbiologin, Forschungsinstitut für Naturmanagement, Texel, Niederlande
Dr. Theo Colborn, Senior Fellow, World Wildlife Fund, Washington, DC
Dr. Gerald R. Cunha, Entwicklungsbiologe, Universität von Kalifornien-San Francisco
Dr. William Davis, Forschungsökologe, Umweltforschungslabor, U.S. Environmental Protection Agency, Sabine Island, FL
Dr. Klaus D. Dohler, Direktor, Forschung, Entwicklung und Produktion, Phar-ma Bissendorf Peptide GmbH, Hannover, Deutschland
Glen Fox, Schadstoffauswerter, National Wildlife Research Center, Environment Canada, Quebec, Kanada
Dr. Michael Fry, Forschungsfakultät, Abteilung für Vogelkunde, Universität von Kalifornien-Davis
Dr. Earl Gray, Abteilungsleiter, Abteilung für Entwicklungs- und Reproduktionstoxikologie, Health Effects Research Laboratory, U.S. Environmental Protection Agency
Dr. Richard Green, Professor für Psychiatrie in Residence, Medizinische Fakultät, Universität von Kalifornien-Los Angeles
Dr. Melissa Hines, Assistenzprofessorin an der Medizinischen Fakultät der Universität von Kalifornien-Los Angeles
Timothy J. Kubiak, U.S. Fish and Wildlife Service, East Lansing, MI
Dr. John McLachlan, Direktor, Abteilung für intramurale Forschung, National Institute of Environmental Health Sciences
Dr. J.P. Myers, Direktor, W. Alton Jones Foundation, Charlottesville, VA
Dr. Richard E. Peterson, Professor für Toxikologie und Pharmakologie, Fakultät für Pharmazie, Universität von Wisconsin-Madison
Dr. P.J.H. Reijnders, Leiter der Abteilung für Meeressäugetierkunde, Forschungsinstitut für Naturmanagement, Texel, Niederlande
Dr. Ana Soto, Außerordentliche Professorin, Tufts University School of Medicine, Boston, MA
Dr. Glen Van Der Kraak, Assistenzprofessor, Universität von Guelph, Ontario, Kanada
Dr. Frederick vom Saal, Professor, Abteilung für Biologische Wissenschaften, Universität von Missouri-Columbia
Dr. Pat Whitten, Assistenzprofessorin, Abteilung für Anthropologie, Emory University, Atlanta, GA