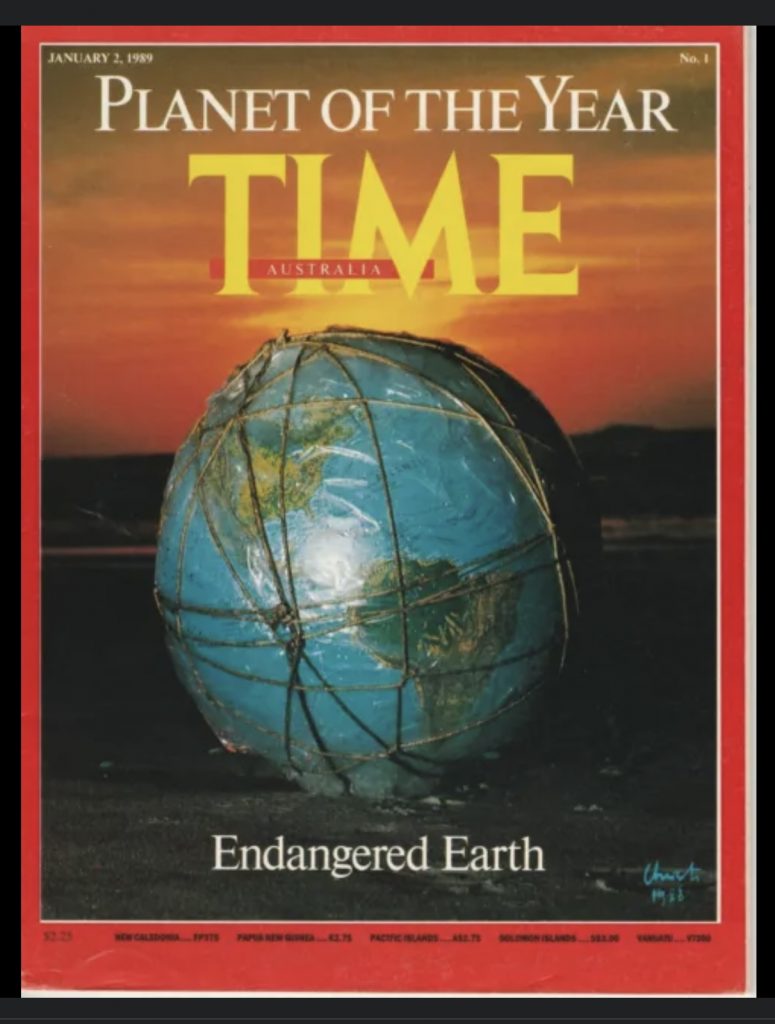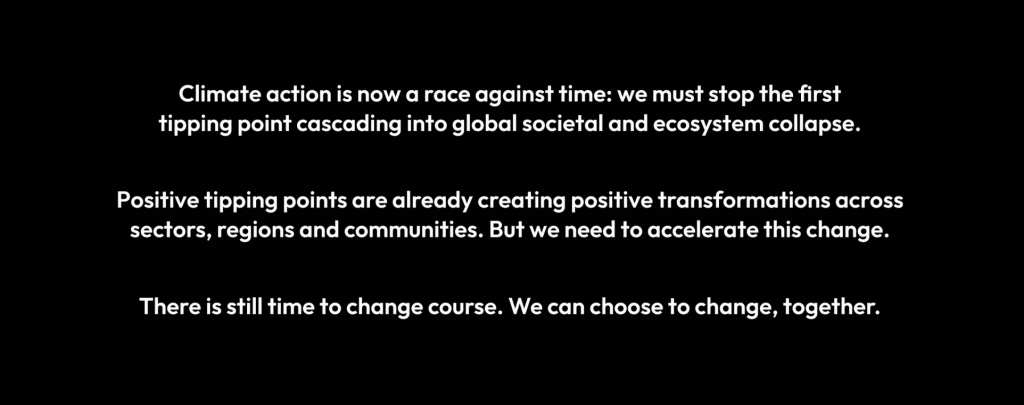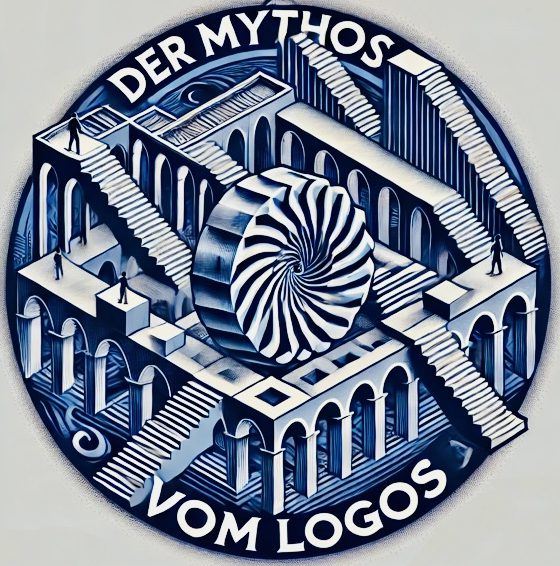English summary
(Aktualisiert Dezember 2025)
Die gesamte Geschichte, unabhängig von Zeit und Ort, durch zieht das Phänomen, dass Regierungen und Regierende eine Politik betreiben, die den eigenen Interessen zuwiderläuft. In der Regierungskunst, so scheint es, bleiben die Leistungen der Menschheit weit hinter dem zurück, was sie auf fast allen anderen Gebieten vollbracht hat.
Barbara Tuchmann, 1912-1989
Der Krieg ist bloß eine Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln.
Carl von Clausewitz, 1780 – 1831
Es gibt eine unaufhaltsame und erschreckende Evolution der Krieges. Viel zu oft hat sich der vermeintlich Stärkere mit brutaler Waffengewalt durchgesetzt und nur Schutt, Asche und Berge von Leid sind geblieben.
Der Philosoph Heraklit bezeichnet den Krieg als „Vater aller Dinge„. Das ist insofern richtig, als Gewalt sicherlich nicht die Mutter aller Dinge ist. Die Annahme, dass Kriege und Naturkatastrophen wirtschaftlich positive Auswirkungen haben können, erweist sich als Illusion (Parabel vom zerbrochenen Fenster).
Krieg
Im Februar 2022 hat der russische Präsident Putin die Ukraine angegriffen. Die Auswirkungen durch diesen Akt der Aggression werden die europäische Zukunft in eine neue und mutmaßlich unerfreuliche Richtung lenken. Es soll dabei nicht vergessen werden, welchen Anteil an dieser Entwicklung die falschen politischen Entscheidungen der USA und der NATO hatten (Sarotte, 2024). Die Verzweiflung, und der anwachsende Hass auf beiden Seiten der Front werden Europa auf Jahrhunderte vergiften. Die willentliche Zerstörung des Kachowka-Staudamm durch die russischen Besetzertruppen in der Nacht zum 06.06.2023 verändert über Jahrzehnte das Erscheinungsbild und die Ökosysteme im Süden der Ukraine. Der schnelle Sieg, den sich Putin versprochen hat, wurde nicht erreicht. Die Situation gleicht eher der von Verdun im großen Krieg von 1914-18. Außer, dass heute große Mengen von russischen Mörder-Drohnen unterwegs sind, um in Wohngebieten, Schulen und Krankenhäusern Angst und Schrecken zu verbreiten.
Im Juli 2024 wurde bekannt, dass amerikanische Raketensysteme ab 2026 wieder in Deutschland stationiert werden sollen. Der Krieg wird wieder kälter. Die Diplomatie hüstelt und … schweigt. Die irren Autokraten berechnen kalt ihre Chancen auf ‚einen guten Deal‘. Auf mehr dürfen wir nicht mehr hoffen.
Im Oktober 2023 überfallen tollwütige Hamas-Kämpfer aus dem Gazastreifen angrenzende Siedlungen in Israel, unter anderem ein Musikfestival. Unschuldige Israelis werden angegriffen, vergewaltigt, verschleppt, getötet. Es ist verständlich, dass der Staat Israel Vergeltung im Gazastreifen übt. Aber die erschreckenden Opferzahlen unter der Bevölkerung in Gaza lassen Zweifel aufkommen, ob es sich hier noch um das alttestamentarische Auge-um-Auge Prinzip handelt, sondern um eine aus dem Ruder laufende militärische Mordmission (Statista, 2024).
Im Juni 2025 bombadiert Israel mit Billigung und militärischer Unterstützung der USA den Iran und gießt weiteres Öl ins Feuer. Das Argument der Notwehr wegen des drohenden Einsatzes der Atombombe durch den Iran erinnert an die Begründungen für den Irak Krieg durch die USA. Das Leid der Menschen im Gazastreifen gerät aus dem Blickfeld. Wir gewöhnen uns an die ständigen Steigerungen der humanitären Katastrophe.
Die Leidtragenden sind immer vor allem Zivilpersonen.
In der Evolution der kriegerischen Konflikte weltweit hat sich das Verhältnis zwischen getöteten Soldaten vs. Zivilisten in diesem Jahrtausend zu Ungunsten der Zivilisten verschoben (8:1 heute 1:8). Nicht der Kampf der Soldaten gegeneinander verbreitet den meisten Schrecken, sondern der überraschende Einsatz von Streubomben und Killerdrohnen gegen Wohnblocks und Einkaufscenter. Der Gegner soll demoralisiert werden. So wurde es auch beim Einsatz von Napalm im Vietnamkrieg (1955–1975) begründet. Mein moralisches Empfinden ist im Krieg ausgeschaltet. Niemals käme ich in Friedenszeiten auf die Idee, mit einer Chemikalie, wie Agent orange, Wälder zu entlauben.
Wie immer sind die Begründungen für die Aggression lächerlich und vorgeschoben. Oft wird ein göttlicher Wille als Rechtfertigung angeführt.
Warum gebe ich nicht zu, ein Monster zu sein?
Kein Gott befiehlt mir, kein Gott verhindert es.
Ich sehe verzweifelt auf die unendliche Historie der Testosteron getriebenen Männer. Wo sind die Sanftmütigen geblieben? Wurden sie alle gekreuzigt, erschossen, erschlagen, ertränkt und damit final aus dem Genpool entfernt? Gab es sie überhaupt? In der unüberschaubaren Aufeinanderfolge von Kriegen und kriegerischen Auseinandersetzungen (ALCED, UCDP) sind fast ausschließlich Männer als Täter beteiligt – nicht nur alte weiße Männer – sondern Männer auf allen Kontinenten, alte und junge Männer. Soldaten mit regulären Uniformen, Partisanen, Freiheitskämpfer und Terrormilizen wie zum Beispiel Boko-Haram, IS, M23 unter dem Befehl von religiösen Fanatikern und Warlords (Charles Taylor, Mohamed Farrah Aidid). Und natürlich Autokraten, für die das Militär wichtiger ist, als Lebensmittel für das eigene Volk (Kim Jong-Un).
Wenn ein Mensch besonders grausam handelt, dann spreche ich vom „Tier im Menschen“. Wohl wissend, dass kein Tier ist zu einer derartigen Quälerei seiner Mitgeschöpfe in der Lage ist (Dostojevski 1880).
Der Krieg ist in die Gene der Menschheit eingeschrieben – er hat seine eigene Evolution (Azar Gat, 2008). Ich bin unglaublich kreativ bei der Erfindung von Waffensystemen (Latiff, 2018). Und ich finde einen Grund, warum ich selbst meinen Bruder umbringen muss. In der Schöpfungsgeschichte steht zu Beginn der Brudermord. Das Motiv für diesen ersten Mord der Menschheit war eine Kränkung – und dieses Motiv zieht sich mit erschreckender Konstanz durch die Menschheitsgeschichte: Der gekränkte Mann tötet – er übertötet.
Panzer und Kanonen ragen wie Dauererektionen in den Himmel und spritzen Tod und Verderben in die Welt. Und die Interkontinentalrakete – ein monströser metallischer Phallus – in den unterirdischen Abschuß-Silos der Weltmächte -wartet darauf, die Zivilisation auszulöschen. Killerdrohnen, die fliegenden ferngelenkten Monster, können jeden von uns erreichen. Das Bedienpersonal, in angenehm klimatisierten Räumen, sitzt mit einem Joy-Stick in der Hand und wartet auf Befehle. Mit diesem „Freuden-Knüppel“ wird aus sicherer Entfernung getötet – fast wie in einem Videospiel und mit KI Unterstützung (Gaza Krieg)
Beispiele für meine Gewalttätigkeit gibt es unzählige. Wenn ich mir eingestehen würde, wozu ich fähig bin – das wäre die größte Kränkung der „Männer-Menschheit“ – man-kind.
Welches Entsetzen habe ich erzeugt, als ich die chancenlosen Ureinwohner von Nord- und Südamerika mit Schusswaffen überwältigt und niedergemetzelt habe. Ganz nebenbei habe ich die indigenen Völker mit den Krankheiten dezimiert, die ich aus der alten Welt mitgebracht habe. Nicht zu vergessen, dass ich sie mit der verheerendsten aller Drogen bekannt gemacht habe – dem Alkohol.
Im Ersten Weltkrieg habe ich damit begonnen, Giftgas gegen feindliche Soldaten einzusetzen, die davon völlig überrascht wurden. Welches Entsetzen muss in den Schützengräben geherrscht haben? Ich denke an die verstörenden Bilder von Verdun nach dem Ende der Beschießung.
Eine besonders gewalttätige Epoche war das „Dritte Reich“, das sogenannte „Das Reich der Vernichtung“. (Kay, 2022). Nicht wenige sehnen sich heute in alte Zeiten zurück und leugnen oder verharmlosen die unmenschlichen Verbrechen (Angrick, 2022) in den grauenhaften Fabriken des Todes und in den besetzten Ländern (Schuldkult).
Niemals dürfen wir zulassen, diese Verbrechen an der Menschlichkeit, begangen durch SS, Polizei und Wehrmacht vergessen werden.
Am 16.07.1945 um 05:29 wurde in Los Alamos in den USA der erste Plutonium-Bombentest durchgeführt. Ich war mir nicht ganz sicher, ob die folgende Kettenreaktion endet oder der in der Luft enthaltene Sauerstoff eine globale Reaktion auslöst und die gesamte Menschheit vernichtet. Das hat mich aber nicht abgehalten. Als das Prinzip der neuen Technik erfunden war und die Uran-(Little Boy) und die Plutonium (Fat man)-Technik verglichen werden sollte, habe ich, in vollem Bewusstsein meines Irrsinns, einen monströsen Feldversuch durchgeführt. Hiroshima und Nagasaki sind der Inbegriff des atomaren Wahnsinns geworden. Innerhalb der ersten Stunden starben 100.000 Menschen in den beiden Städten. Die Opfer waren auch Zwangsarbeiter aus Korea, China und Taiwan.
Vor 80 Jahren habe ich den atomaren Teufel von der Kette gelassen. (IPPNW.DE)
Die Rüstungsausgaben der Welt steigen unaufhörlich (Rüstungsausgaben in Zeiten des Ukraine Krieges). Das hat mit dem Keulen-Paradoxon zu tun. Da ich mir nicht sicher bin, ob ich die größte Keule schwinge, um meine Interessen durchsetzen, rüste ich pausenlos auf. Das sieht mein Nachbar und tut Gleiches. Mein Bestreben, größere Sicherheit zu erlangen, erreicht also genau das Gegenteil. Gegen meine Savanneninstinkte kann ich aber nichts tun. Außerdem gibt es nicht wenige Menschen, die damit viel Geld verdienen. Die Welt bekommt das, was die Aktionäre reich macht.
Für Verständigung braucht es zwei Parteien, für Aggression genügt eine. Der Naturzustand von Thomas Hobbes ist nur scheinbar überwunden. (Hobbes, 1651) – Es heißt: Alle gegen Alle und Aggression kann nur durch Aggression beantwortet werden. Aber ist das wirklich der einzige, der richtige Weg? Ich nenne es Gleichgewicht des Schreckens und bin ernsthaft von der Richtigkeit dieses (männlichen) Handelns überzeugt. Die Zeit bis zum Untergang läuft ab (Doomsday Clock, 2025).
Mein grundlegender Denkfehler ist: Wenn ich keine Gewalt ausüben kann, dann habe ich keine Macht. Aber das ist falsch, wie schon Hannah Arendt 1970 ausführte. Macht entsteht nicht dadurch, dass ich eine Keule schwinge oder Maschinengewehre auf Demonstranten richte. Das ist im Gegenteil ein Zeichen meines Macht Verlustes, den ich mit kompensatorischer Härte zu verhindern suche (Arendt, 1970).
Die, angesichts der globalen Probleme, dringend notwendige Zusammenarbeit der Weltgemeinschaft ist eine ferne Illusion.
Krieg kennt keine Gewinner, diese Wahrheit will ich nicht begreifen.
Geld, Energie, Ressourcen aller Art werden in verantwortungsloser und unwiederbringlicher Art und Weise für den Bau und die Unterhaltung immer neuer Waffensysteme verbraucht. Diese Ressourcen fehlen mir für wichtige, dringend notwendige Unternehmungen – zum Beispiel die Bekämpfung der Klimakrise. Möglicherweise werde ich den globalen Klimawandel aber durch einen weltweiten Fall-out und globale Asche-Wolken ‚wirksamer‘ bekämpfen, als mir lieb ist.
Das Militär ist weltweit einer der größten Emittenten von CO2. Die Umweltbelastung allein durch den militärischen Fuhrpark und die Flugzeuge sind enorm (The military emissions GAP). Gleichzeitig sorgt sich das USA Verteidigungsministerium um eine sich möglicherweise rasch verändernde geopolitische Lage – angesichts der Klimakatastrophe. Es betreibt Analysen, um auch bei Wetterkastatrophen, Epidemien, Flüchtlingswellen und Zerfall der staatlichen Ordnung kampf- und siegbereit zu bleiben. Im Verteidigungsministerium der USA wird der Klimawandel ernst genommen (Risikoanalyse des DoD von 2021). Zumindest bis zur Ära des 47.Präsidenten D.Trump.
Die Altlasten vergangener Kriege liegen als Landminen im Boden und zerfetzen die Menschen, die den Boden ahnungslos bearbeiten wollen (taz 02,2025). Die umkämpften Gebiete der Ukraine werden gerade im Moment wieder ausgiebig vermint. Die Bomben des 2. Weltkrieg machen in Deutschland Probleme. (Berlin, 2022)(Dresden, 2025) Jährlich müssen 5000 Blindgänger entschärft werden. Geschätzt liegen noch 100.000 – 300.000 Tonnen im Boden versteckt. Kriegsmaterial liegt auch am Boden der Ozeane, verrottet dort und vernichtet unaufhaltsam Stück für Stück maritimes Leben. Die Kosten für all das habe ich nie berechnet, kann ich gar nicht berechnen. (UBA, 2023, taz Artikel 05 2024, Le monde diplomatique 2024).
Krieg und Wirtschaft
Es tobt der Kampf der neoliberalen Wirtschaftsordnung – Ich kämpfe auf dem Parkett des Börsenhandels und in den Etagen der Investmentbanken. Ich kämpfe auf den internationalen Märkten um Gewinne, Einfluß und Macht. Es werden Wirtschaftskriege geführt, die den Gegner zwingen sollen, meine Bedingungen zu erfüllen. Freihandelsabkommen werden geschlossen, um gegenüber dritten Parteien im Vorteil zu sein. Zölle werden verhängt, um die eigene Wirtschaft zu schützen. Darauf reagieren die Handelspartner mit Gegenzöllen. Eine Partnerschaft sind anders aus.
Es ist die Zeit der Dealmaker und auch der Lobbyisten. Waffenhändler haben Hochkonjunktur. Auch für Länder, die sich als Demokratien und als fortschrittlich verstehen, ist es sehr ein lukratives Geschäft, Waffen zu verkaufen. Waffen werden in Krisengebiete geliefert, zur Verteidigung, zum Angriff oder um sie weiter zu verkaufen.
Die Börsenkurse für Rüstungsunternehmen nach 3 Jahren Krieg in der Ukraine entwickeln sich prächtig. Ob die Lobbyisten bei Bestechungen der verantwortlichen Politiker auffliegen oder nicht – ob es Gesetze zur Begrenzung des Rüstungshandels gibt oder nicht – es gibt immer ein Schlupfloch für meine zerstörerischen Waffenverkäufe. Und Waffen zerstören, daran besteht kein Zweifel – außer bei Hardlinern wie der National Rifle Association in den USA.
Wenn der Staat seine Schutzfunktion nicht mehr gewährleisten kann, bewaffnen sich die BürgerInnen und suchen Schutz durch die eigene Waffe. In den USA ist der freie Homo sapiens sapiens stolz darauf, Waffen tragen zu dürfen. Dies ist ein Zusatzartikel der Verfassung – im Gegensatz zur Gleichberechtigung der Frau. Allerdings resultiert aus der Menge an Waffen in Wahrheit keine größere Sicherheit. Die Anzahl der durch Schusswaffen verursachten Tötungs- und Verletzungsdelikte nimmt kontinuierlich zu (Gun violence archiv).
Waffen jeder Art zerstören nicht nur Vertrauen und Glaubwürdigkeit unter einander, sondern auch ökologische Gleichgewichte und beeinträchtigen somit die körperliche Unversehrtheit von Menschen.
Ich kann nur hoffen, dass in den Ländern, in denen meine Waffen zum Einsatz kommen, die Anzahl der Überlebenden gering ist. Sonst machen sie sich irgendwann auf den Weg – flüchten, weil sie keine andere Möglichkeit haben – und zerstören die Stabilität meiner heilen Welt. Keine noch so hohen Mauern und Zäune werden helfen. Wenn die Anzahl zerstörter, dysfunktionaler Länder und Staaten wächst, werden mit Sicherheit Millionen Menschen flüchten müssen. Verzweifelt bin ich schon heute dabei, meine Besitztümer abzusichern (Frontex).
Die Verteilung in meiner Welt ist zynisch: Die einen verdienen, die anderen sterben. Die Mehrheit verliert – eine Minderheit wird reich.
Ich bin mir sicher, dass der Kampf um die endlichen Ressourcen dieser Welt angesichts der fortschreitenden ökonomischen und ökologischen Ungleichgewichte noch nicht einmal begonnen hat und sich noch verschärfen wird. Der Kampf um Wasser, um Land oder Bodenschätze, um Energie, kurz gesagt, um Einflussnahme in dieser Welt wird mit militärischen Mitteln und mit zunehmender Härte geführt.
Ich will es nicht wahrhaben – aber meine Aggression wird uns umbringen.
Ich nehme schon heute billigend in Kauf: Die Vertreibung von Menschen, den Tod von Bootsflüchtlingen und die unwürdigen Zustände in Flüchtlingslagern. Als Provisorien gedacht, werden sie bald zu einer Dauerlösung. Dort entsteht neuer Hass und Gewalt. Auch die Idee, Flüchtlinge ungefragt und ohne Verfahren in afrikanische Länder (Ruanda) abzuschieben, zeigt meine Hilflosigkeit mit der Krise umzugehen. Der Wahlkampf 2025 wird von der Diskussion über Migration beherrscht (Tagesschau, 01 2025). Dabei sollte ich vielmehr über den fanatischen Islamismus diskutieren, seine Ursachen und seine Bekämpfung.
Kriege und Krisen verursachen Armut, die neben Flucht zu Prostitution, Sklaverei oder der Zwangsverpflichtung durch skrupellose Organisationen führt. Dies führt zu einer Radikalisierung, die durch Hass und Verzweiflung begründet ist. Ein weiteres Resultat von Krisen sind Sklavenarmeen, die wiederum zu vermehrter Gewalt führen.
Neben dem Universum der Armut existiert das dunkle Universum von weltweitem Drogen-, Waffen- und Menschenhandel; von Geldwäsche, Korruption, Cyber-Kriminalität und Umweltverbrechen (BKA 2024, Tagesschau 2024). Es ist eine Schattenwirtschaft des Bösen – und sie floriert. Wenn staatliche Handlungsfähigkeit aufgrund einer libertären und populistischen Ideologie eingeschränkt wird, kommt es zwangsläufig zu einer Expansion der internationalen Kriminalität, bei der hohe Gewinne auf Kosten von Leib und Leben Unschuldiger erzielt werden. Den gleichen Effekt hat es, wenn Länder in Dysfunktionalität versinken und die Regierung/Verwaltung ihre Aufgaben nicht mehr wahrnimmt (Failed state).
Krieg und Propaganda
Ich bin von einer mitreißenden Rede so begeistert, dass ich gar nicht verstehe, worum es eigentlich geht. Mir fallen die Widersprüche, die falschen „Fakten“ und die subtile Beeinflussung nicht auf. Ich begreife nicht, dass der Redner einen bösen und eigennützigen Plan verfolgt.
Brüllt der Redner: „Willst du den totalen Krieg?‘“ dann bin ich begeistert und antworte: „Ja!‘“ So etwas kann nur passieren, wenn das eigene Denken, die eigene moralische Empfindung ausgeschaltet ist. So handelt nur jemand, der das Elend nach der Katastrophe nicht aufräumen muss. Jemand, der seine eigenen Kinder im Angesicht des Scheiterns vergiftet und sich dann erschießt. (Magda Goebbels). Die deutschen Nationalsozialisten waren keine Aliens, die über das Land kamen und es verwüstet haben. Sie haben sich auch nicht in Raumschiffen nach der Katastrophe davongestohlen. Sie waren Du und Ich, Nachbarn und Freunde. Hinterher hat es niemand gewollt oder gewusst.
Beispiele für verheerende Propaganda gibt es viele. Es sind schreckliche Erzählungen des irregeleiteten menschlichen Handelns; Erzählungen von der naturgegebenen Überlegenheit des Einen gegenüber dem Anderen, die alle letztlich zum Untergang, zum Krieg, zum Genozid geführt haben. Es ist der Mythos von der überlegenen Rasse. Wann wird mir bewußt, dass es unterschiedliche Rassen nicht gibt? Es gibt Ethnien, Bevölkerungsgruppen – kurz es gibt menschliche Vielfalt. Und eine Herrenrasse gibt schon gar nicht.
Das Problem ist die unglaubliche Menge an Informationen, an Meinungen und unterschiedlichsten Kanälen, die mich ständig erreichen und die um meine Aufmerksamkeit kämpfen. Ich ersticke nicht nur im Plastikmüll, sondern auch im Informationsmüll. Alle drängeln sich vor, in Podcasts, in Videos, in Kurzmitteilungen mit oder ohne die Unterstützung von ChatGPT und Kollegen. Alle wollen mir die Welt erklären – dabei haben sie nicht immer gute Absichten.
Wenn es um komplizierte Zusammenhänge geht, werden sie oft in unzulässiger Weise vereinfacht. Ich habe leider keine Zeit oder Lust, mich mit den Details zu befassen, und verlasse mich auf die Zusammenfassung, auf das Schwarz und Weiß. Wird meine Meinung bestätigt, um so besser. Es geht nicht um Fakten, es geht nur um Emotionen. Das weiß ich, das wissen alle anderen auch. Insbesondere der Homo politicus, der mich regiert, den ich mich regieren lasse, ist sich dieser Tatsache bewußt. Er arbeitet damit. Meine altehrwürdige Savannen-Programmierung ist fasziniert von dem großen (An)Führer, der mich an die Hand nimmt und sicher durch den Dschungel führt.
Die Debatten werden zunehmend hektisch in einem schrillen Ton geführt. So, als wollten wir zum Ausdruck bringen: „Ich bin nicht deiner Meinung, egal welche sie auch sein mag, werde nicht dafür eintreten, dass du sie sagen darfst, sondern werde dich einschüchtern und notfalls gewaltsam am Reden hindern.“
Es handelt sich also um die radikale Umkehrung des bekannten Zitates: „Ich missbillige, was Sie sagen, aber ich werde bis zum Tod Ihr Recht verteidigen, es zu sagen.“ Dieses Zitat, welches Voltaire zugeschrieben wird, stammt in Wirklichkeit von einer Biographin von Voltaire, von Evelyn Beatrice Hall, die damit Voltaires Gedanken zusammenfassen wollte.
Beschimpfungen und die Androhung von Gewalt und Tod sind die neue Normalität, sind zu scheinbar ’normalen‘ Umgangsformen geworden. Wer sich in diesem lauten und brutalen Wettbewerb um die Deutungshoheit nicht behaupten kann, wird niedergeschrien. Schließlich verstummt die letzte Stimme, die zur Vernunft mahnt und zur Rücksichtnahme.
Ich will einfach nicht begreifen, dass weder eine Einzelmeinung, noch die Meinung einer Gruppe hilfreich ist. Zur Bewältigung der globalen Probleme braucht es eine globale Intelligenz – gefolgt von globalem Handeln.
Das Problem ist: Die globale Intelligenz gibt es nicht. Schwarmintelligenz ist beim Homo sapiens sapiens in Wirklichkeit eine Form der Schwarmdummheit.
Krieg und Frauen
„Deshalb wird innerhalb der Menschheit der höchste Rang nicht dem Geschlecht zuerkannt, das gebiert, sondern dem, das tötet.“ (Beauvoir, 1949)
„Ich werde das Gefühl nicht los, dass der Krieg eine Schöpfung der männlichen Natur ist, mir in vieler Hinsicht unbegreiflich.“ (Alexijewitsch, 2016)
Krieg ist eine männliche Heldentat. Obwohl Krieg tötet, verstümmelt, verängstigt, also eine unaussprechliche Bedrohung des menschlichen Lebens ist. Männer töten Männer, Frauen und Kinder. Ist dem Mann das Leben nichts wert?
Der männliche Homo sapiens sapiens ist vergleichsweise kurz an der Entstehung neuen Lebens beteiligt – meist lustvoll. Im Gegensatz dazu hat die weibliche Homo sapiens sapiens nach der Zeugung 9 Monate Streß vor sich. Unwohlsein, Schmerzen und Ängste, eine Umstellung des Hormonhaushalts und schließlich eine nicht ungefährliche und höchst schmerzhafte Geburt. Die Risiken einer Schwangerschaft sowohl für die werdende Mutter als auch für das Kind sind beim Homo sapiens sapiens nicht unerheblich (Bohannon, 2024). Eine Frau ist nicht mal ebenso, nebenbei schwanger. Das neu entstehende Leben ist für sie wunderbar und kostbar.
Dann bedarf das neue Wesen jahrelanger Pflege und Fürsorge, wie im Tierreich im Wesentlichen eine weibliche Aufgabe – außer beim Hippocampus, dem Seepferdchen (Hein, 2021). Obwohl Frauen damit einen überproportional großen Anteil zur Arterhaltung beitragen, wird ihr Einsatz von Männern oft nicht gewürdigt.
Im Gegenteil: Damals wie heute werden Frauen systematisch benachteiligt, von Bildung ausgeschlossen und dürfen ihrer ‚natürlichen‘ Pflicht an Heim und Herd nachkommen (Beauvoir, 1949). Dieses universelle Verhalten beobachten die Ethnologen als Konstante der Menschheit (Müller, 1984). Daran hat auch die #metoo-Debatte nichts geändert.
Frauen werden unsichtbar gemacht, versteckt hinter Mauern, hinter Schleiern, hinter verschiedenartigen, hinter kleinen und großen Benachteiligungen im Alltag. Überall auf der Welt, jeden Tag. (Criado-Perez, 2020)
Ich, der männliche Homo sapiens sapiens, schüchtere Frauen ein, jage sie in die Dunkelheit und erkläre sie für minderwertig. Und ich tue ihnen sekündlich körperliche und seelische Gewalt an – weltweit. Weibliche Genitalien werden verstümmelt; Frauen werden vergewaltigt und ermordet. Die Weltreligionen schauen überwiegend wohlwollend, zumindest schweigend zu. Sie betonen zwar häufig die spirituelle Gleichwertigkeit der Geschlechter, doch spiegelt sich dies selten in ihrer Praxis wider. Kulturelle Einflüsse und patriarchale Strukturen haben dazu beigetragen, dass Frauen historisch als minderwertig angesehen wurden und weniger Rechte haben. Eva entstammt aus einer Rippe Adams, sie ist schmutzig und unrein. Die Menstruation macht dem männlichen Homo sapiens sapiens seit jeher Angst. Menstruierende Frauen sind seit grauer Vorzeit in allen Kulturkreisen am Unglück der Männer schuld. Ebenso absurde Theorien über einen „wandernden unbeschäftigten Uterus„, der bei Frauen Krankheiten verursacht, stammen von Hippokrates – dem Vater der „modernen“ Medizin – und wurden über Jahrhunderte gelehrt (Cleghorn, 2022)(Supplement 6).
Was ist das für eine Welt, wenn ich, als männlicher Homo sapiens sapiens, den Frauen ihre Selbstbestimmung über Sexualität und Fortpflanzung verwehre? In vielen Ländern werden die Möglichkeiten einer legalen Abtreibung heute zunehmend eingeschränkt. (Vereinigte Staaten von Amerika). Und bis heute existiert in den USA kein Zusatzartikel in der Verfassung, der eine Gleichbehandlung von Männern und Frauen festschreibt (Equal Rights Amendment).
Und die zu kurz gekommenen, angeblich benachteiligten Männer, die keine abgekriegt haben, verbreiten sich bitterböse in Internet Foren, wie schlecht die Welt ist (INCEL). Immer wieder die Macht der Kränkung.
Ich, der herrschende Mann, verteidige mich mit einem irreführenden Narrativ: Dass der Feminismus Männer unterdrücken will. Dass Frauen die Gleichberechtigung schon erreicht hätten und nun alles gut sein muss. Geradezu hysterisch reagiert der konservative Mann auf den Versuch, die Lebenswirklichkeit von Frauen, Männern und Nichtbinären in gerechte Sprache umzusetzen und nennt es Gender-Wahnsinn.
Ich, als unterdrückte Frau, lasse es geschehen. Herrschaft entsteht dadurch, dass die Beherrschten still halten und die herrschende Ordnung als gegeben hinnehmen.
Homo sapiens sapiens vernichtet und mißachtet nicht zuletzt die Hälfte seiner geistigen Kapazität: Weil Mann das schöpferische und geistige Potenzial von Frau nicht anerkennt. Oder -noch perfider- Mann nutzt es und gibt es als männliche Geistestat aus. Da dürfen wir uns über den bescheidenen Zustand der Welt nicht wundern. Aufgrund der männlichen Ignoranz und Überheblichkeit gingen und gehen auch weiterhin viele wissentschaftliche Gedanken und kostbare Emotionen, mithin Lösungen für unsere weltweiten Probleme, verloren.
Wenn Frauen sich nicht meiner männlichen Verführung beugen, werde ich sie verfluchen – so dass niemand ihren düsteren Voraussagen Glauben schenkt.
Sage mir nicht meine Zukunft voraus, Kassandra, denn ich fürchte mich vor deinen Worten.
Krieg und weiter?
Ich benötige kein Patriachat, kein Matriarchat, sondern: die Herrschaft der vernünftigen Menschheit.
In einer idealen Welt könnte das gelingen, aber da sind wir nicht.
Dem unglaublichen Leid meiner Kriege gedenke ich heuchlerisch auf einem Festakt mit einer Kranzniederlegung. Aber die Waffen lege ich nicht nieder. Die Toten klagen nicht. Die Trümmerfrauen müssen aufräumen, das tun sie immer. Die traumatisierten Kinder, die Gewalt erlebt haben, tragen sie in ihren Herzen – und in ihren Genen– weiter. Wut, Hass und Gewalt werden in den kommenden Generationen fortgeschrieben.
In einer Welt, in der scheinbar alles mit allem vernetzt ist, entfernen wir uns von einer gemeinsamen globalen Abstimmung. Je mehr wir miteinander vernetzt sind, desto weniger können wir uns auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Es gibt keine globale Instanz, die die unterschiedlichen Denkansätze moderiert und eine Lösung findet, die zukunftsvernünftig ist.
Der Logos schweigt. Vernünftig hieße in diesem Zusammenhang – mit Rücksicht auf meine begrenzten geistigen Fähigkeiten: Ich kann zumindest heute noch nicht erkennen, dass meine Handlungen morgen Unheil hervorrufen. Zukunftsvernunft würde das Überleben meiner Spezies sichern, vielleicht jedenfalls.
Aber das Überleben meiner Art scheint mir völlig gleichgültig zu sein. Das unterscheidet mich elementar von meinen Mitgeschöpfen.
So beschäftige ich mich mit politischen Zielen, die einigen Wenigen kurzfristig Vorteile bringen und verbiete mir jede Diskussion über die Zweckmäßigkeit meines Handelns für künftige Generationen und den ganzen Erdkreis. Ich schreibe viele kluge Zeilen, in denen ich das Weltethos beschwöre, aber es gibt es nicht. (Küng, 1996) (Schweitzer, 2013). Stattdessen gibt es ohne Unterlass Gewalt und Krieg.
Fehlt mir also der Mut zum Frieden, zum Nachgeben, zum Verhandeln?
Fehlt mir die Fähigkeit zur sachlichen Moderation, zum Ausgleich, zum Verzicht auf Rache?
Die Probleme der Welt, besser: die Probleme von Homo sapiens sapiens werden nicht durch Aggression und Dominanz gelöst, sondern durch Kooperation, durch Teilen und Nachgeben. Oder wie Erich Fromm es ausdrückt: „Der Wille zu teilen, zu geben, zu opfern.“ (Fromm, 1979).
„Die Menschen haben jahrelang über Krieg und Frieden geredet. Aber jetzt können sie nicht mehr darüber reden. Es gibt in dieser Welt keine Wahl mehr zwischen Gewalt und Gewaltlosigkeit. Entweder Gewaltlosigkeit oder Nicht-Existenz.“ (Martin Luther King Jr.)
Dass MLK jr. nicht nur ein radikaler Gegner der Rassendiskriminierung, sondern auch des Vietnamkrieges und der sozialen Ungerechtigkeit im Amerika der 50/60er Jahre war, scheint in Vergessenheit geraten zu sein (Eig, 2024).
Hier geht es zur Einleitung
Hier geht es zu Kapitel I
Hier geht es zu Kapitel II
Anfang Kapitel III
Hier geht es zu Kapitel IV
Hier geht es zum Epilog
English Summary