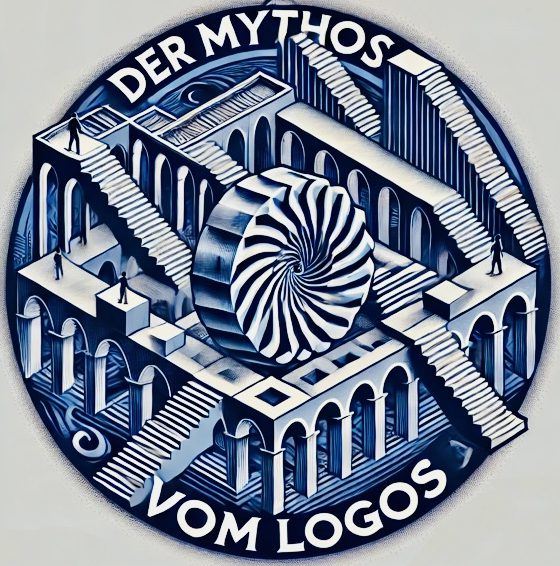(Aktualisiert Februar 2026)
Wir lernen aus der Geschichte, dass wir überhaupt nichts lernen.
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831)
„Ich fürchte mich so vor der Menschen Wort“, schrieb Rainer Maria Rilke 1899. Und doch will ich das Wort an euch richten: Schwestern, Brüder und andere, wie ihr euch auch immer nennen und fühlen wollt.
Auch wenn ich mich fürchte und mir sicher bin, dass das, was nun folgt, niemand gerne lesen, geschweige denn wissen will. Die menschliche Sprache ist eine schreckliche Waffe, vermutlich die schrecklichste überhaupt. Denn mit der Sprache kam nicht nur die Fähigkeit zur Kooperation in die Welt, etwa gemeinsam zu jagen oder einander vor Gefahren zu warnen. Auch die Lüge kam in die Welt.
Hier spricht Homo sapiens sapiens.
Der Jetztzeitmensch, der besonders weise.
Weil ein einfaches ‚sapiens‘ nicht ausreicht, um meine Weisheit zu beschreiben, habe ich es verdoppelt. Bescheidenheit ist nicht meine hervorstechende Eigenschaft. Meine Stimmung schwankt zwischen ängstlicher Verzagtheit und größenwahnsinnigem Narzissmus, wobei letzterer meine bevorzugte Maskerade ist (Richter, 1979).
„Im Anfang war das Wort“ (Johannes Evangelium 1,1).
Das ist natürlich meine Erfindung. Was wirklich am Anfang war, weiß ich nicht. Wahrscheinlich war da nichts – gar nichts. Auch über diesen ominösen Anfang erzähle ich viele Geschichten und erfinde großartige Gottheiten. Ich bin äußerst kreativ im Ausschmücken von Tatsachen, die ich nicht kenne.
Und vermutlich wird auch am Ende aller Tage noch das Wort sein, und ich und meine Mitmenschen werden bis dahin unentwegt geplappert und Geschichten und vor allem Lügen erzählt haben. Diese Geschichten werden nichts, aber auch rein gar nichts, mit dem zu tun haben, worin eigentlich das Problem besteht, was eigentlich die Wirklichkeit ausmacht (Story bias).
Mit der Wirklichkeit habe ich ein großes Problem. Ich mag sie nicht. Schlimmer noch: Ich kann sie nicht einmal erkennen.
Homo narrans nenne ich mich auch. Das Menschen-Tier, das Geschichten erzählt. Das einzige Tier, das Geschichten erzählt (Siefer, 2015).
Die Macht dieser Geschichten ist so groß, dass sie das Universum ausfüllen. Das Universum besteht nicht aus Atomen, es besteht aus Geschichten – so lautet ein Bonmot. Geschichten sind weit mehr als reine Information. Sie schaffen Vertrauen. Sie lassen mich in die Gedankenwelt meines Gegenübers eintauchen. Geschichten schaffen eine oder mehrere parallele, was bedeutet, fiktionale Wirklichkeiten (Framing-Effekt).
Das beruhigt mich – und das ist ein großes Problem:
Ich sollte in keiner Weise beruhigt sein.
Soweit ich es beurteilen kann, erzählen sich Tiere keine Geschichten, und wenn, würde ich sie nicht verstehen. Sie leben in einer anderen, ihrer eigenen Realität. Sie haben genug damit zu tun, den täglichen Anforderungen des Lebens, des Überlebens gerecht zu werden. Sie leben ihre Instinkte. Aber sie schmieden auch Pläne, haben Ideen und empfinden Freude und Trauer. Das habe ich lange Zeit nicht wahrhaben wollen. Und sie wissen nicht, dass es mich, den Homo sapiens sapiens, den Weltzerstörer, gibt und wozu ich fähig bin. Wer weiß, ob sie sonst nicht eine große Revolution gegen mich angezettelt hätten.
Dass auch ich im Wesentlichen instinktiv handle, das will ich nicht wahrhaben. Wir Menschen erfinden pausenlos Geschichten von unserer überbordenden Weisheit. Die nennen wir Narrative; das klingt weise. Diese Narrative müssen nicht unbedingt ausgesprochen werden; ein Bild, ein Video lügt oft mehr als tausend Worte. Ich verbreite sie elektronisch in Sekundenbruchteilen in der ganzen Welt. Ich empfinde dann Glück und das Gefühl der Allmacht.
Als Empfänger bin ich der apokalyptischen Flut von Bildern und Videos fast wehrlos ausgeliefert. Zwar glaube ich fest, ich hätte die Kontrolle darüber, was ich mir ansehe, aber eigentlich entscheidet der Algorithmus (Harari, 2024).
Ich ziehe diese erfundenen Geschichten zu gerne der Wirklichkeit vor; dann werden sie – wie von X-Zauberhand – die wirkliche Wirklichkeit. (Watzlawick, 1976)
Die bunten Erzählungen sind deutlich interessanter als die Realität, die ich sprichwörtlich als grau beschreibe und mit der ich nichts zu tun haben will. Außerdem sind mir meine Geschichten so nahe und vertraut. Schließlich habe ich sie mir ausgedacht: Also müssen sie wahr sein.
„Wir sind alle Geschichtenerzähler, und wir sind die Geschichten, die wir erzählen.“ (William James)
So schaffe ich in Gedanken eine Ordnung in der Welt, die gar nicht vorhanden ist. Ordnung und Symmetrie sind mir wichtig. Unordnung, Neues und Veränderungen machen mir Angst.
Ich habe schon immer die besten Geschichtenerzähler zu Häuptlingen oder Präsidenten gewählt oder in Talkshows eingeladen. Also bin ich bestrebt, Häuptling oder Präsident zu werden, damit ich in Talkshows meine Meinung ausbreiten kann. Ich erzähle seit jeher zunehmend bunte und große Geschichten, die immer weniger mit der Wirklichkeit zu tun haben. Sie dienen aber meinen Machtinteressen.
Meine Mitmenschen hören begeistert zu, applaudieren und geben mir ihre Stimme. Wenn sie das tun, haben sie keine eigene Stimme mehr, und das ist mein Trick. Ich spreche dann für sie, und meine Geschichten stehen im Vordergrund. Das ist auch eine Entlastung von der Verantwortung, selbst denken und entscheiden zu müssen. Meine berühmtesten Reden haben die Weltgeschichte verändert, sie haben Kriege und Revolutionen ausgelöst.
Meine Rede kann töten.
Wenn ich in einer Geschichte lebe, muss ich die Probleme in der Realität nicht akzeptieren oder etwas daran ändern – nein, viel besser: Ich erschaffe meine eigene, schöne Welt. Wenn ein Problem übermächtig erscheint, so wie der Klimawandel, dann sage ich einfach: Es gibt kein Problem mit dem Klima! Oder ich wiegele ab und sage: Die Folgen des Klimawandels betreffen mich nicht! (ZDF heute, Jan. 2025). Jeder, der etwas anderes behauptet, ist ein (links-grüner) Spinner.
Geschichten sind sozialer Schmierstoff, sie lassen Menschen gemeinsam träumen und arbeiten. Die sogenannten „Sozialen Netzwerke“ sind heute meine wirkmächtigen Geschichtsbücher. Da ist für jede und jeden etwas dabei. Ich bin zersplittert in unendlich viele erzählte und erdachte Wirklichkeiten. Das macht mich hilflos und wütend. Gleichzeitig scheint alles und nichts wahr zu sein.
Ich suche mir meine Wahrheit oder Lüge selbst aus und kann sie meist nicht einmal unterscheiden.
Das überaus emsige, nicht unbedingt immer erfolgreiche Zusammenwirken der Menschen hat unsere Zivilisation geschaffen. Wir haben viel erreicht: das Feuer, das Rad, das Buch und die Dubaischokolade.
Das nenne ich Fortschritt. Das ist die allgemein akzeptierte menschliche Erzählung. Darauf bin ich unendlich stolz.
Aber halt: Ein tiefes Unbehagen, das ich kaum in Worte fassen kann. Es ist ein leises Raunen in mir, ein misstrauisches Murmeln. Ich sehe so viele Widersprüche in den alten und neuen Geschichten. Man sagt mir immer wieder, dass wir gemeinschaftlich sparsam sein müssen. Dass ich mich tüchtig anstrengen muss, um ein wertvoller Mensch zu sein. Dass ich alles erreichen und mir in der Gemeinschaft nichts passieren kann. „Niemand wird alleine gelassen„. Ein Narrativ wie „Fördern und Fordern“ bestimmt mein Denken. Aber gilt dieses Versprechen noch, hat es jemals gegolten?
In den periodisch wiederkehrenden Krisen der Finanzmärkte, die kein Ökonom vorhersehen kann oder will, in den Pandemien, für die ich keine Vorsorge treffe, in den Umweltkatastrophen und in den zunehmenden Konflikten und Kriegen, sehe ich staunend auf Zahlen von Finanzmitteln zur Rettung der Situation, deren viele Nullen ich nicht überblicke. Und diese Milliarden werden mit vollen Händen ausgegeben. Nicht unbedingt, um meine eigene Situation zu verbessern – aber daran bin ich gewöhnt.
Eine Krise ist eine wunderbare Gelegenheit, in der sich Einzelne/eine Gruppe bereichern können, während viele leiden müssen und alles verlieren, manchmal sogar ihr Leben (Klein, 2023). Reaktionäre Thinktanks schwurbeln vom Deep State und wollen, um ihn zu bekämpfen, ihre eigene Agenda, ihren eigenen Deep Fake durchsetzen (Project 2025)(Projekt 2025).
Präventives Handeln wäre weitaus billiger und effektiver, aber ich gründe erst eine Feuerwehr, wenn das Haus in Flammen steht. Und dann auch nur widerwillig. Aber immer wieder stehe ich mit Gummistiefeln und entschlossenem Gesicht hinter Sandsäcken, verspreche schnelle und unbürokratische Hilfe, rede mich aber ansonsten aus der Verantwortung heraus. Darin bin ich gut. Mein Gedächtnis ist kurz – unser aller Gedächtnis ist höchst lückenhaft.
Als Geschichtenerzähler komme ich mit dem Erfinden neuer Geschichten gar nicht hinterher. Oder ich gebe mir keine Mühe mehr, die Denk- und Logikfehler in meinen Geschichten zu korrigieren. Es fällt doch keinem auf. Ich kann behaupten: „Die Erde ist eine Scheibe.“ Und es findet sich jemand, der das glaubt. Die absurdesten Meinungen haben Platz und finden fanatische Anhänger. „Das muss man doch sagen dürfen“, beharre ich stur, „das ist Meinungsfreiheit“. Dreimal lügen ist besser, als einmal die Wahrheit zu sagen. Und das ist nur eine von den vielen Merkwürdigkeiten meines Verhaltens.
Was mich besorgt, ist: Über manche Zustände in der Welt spreche ich nicht. Oder sollte ich besser sagen:
Über das Entscheidende spreche ich nicht!
Wenn in der Vergangenheit oder Gegenwart Fehler oder Versäumnisse offensichtlich werden, dann richte ich meinen Blick mit Scheuklappen davon ab und stammle: „Ich muss mich auf die Zukunft konzentrieren und soll das Vergangene vergangen sein lassen.“ oder „Wir müssen jetzt nach vorn schauen!“. Aus Fehlern zu lernen, ist mir als Individuum vielleicht noch in Grenzen möglich, als Menschheit insgesamt ist es offensichtlich unmöglich. Und das, obwohl wir angeblich die Krone der Schöpfung und die Herrschenden der Welt sind.
Ich spreche auch ungern über meine Gewalttätigkeit, oder präziser ausgedrückt, über männliche Gewalttätigkeit. Sicherlich sind nicht alle Männer gewalttätig, aber dort, wo es brutale, herrische Gewalt gibt, wird sie von Männern verübt. Die Geschichte des Homo sapiens sapiens, meine Geschichte, ist von männlicher Gewalt durchzogen, die mich als Spezies zutiefst verletzt und eine endlose Spirale von Hass und Gegengewalt in Gang setzt. Gewalt fasziniert Männer. Die großen Historien (und Hollywood) verherrlichen den starken Mann, den mächtigen Potentaten, Feldherrn und Eroberer. Von denen, die das Schlamassel danach aufräumen müssen, spreche ich auch nicht.
Ich verschweige mir gegenüber ebenso den exzessiven und zunehmenden Verbrauch an Ressourcen meiner Welt, als hätte ich mehrere Welten zur Auswahl und beliebig viel Zeit. Als Spezies habe ich aber weder das eine noch das andere, als Individuum sind mir die Dimensionen in keiner Weise begreiflich und deshalb kümmere ich mich nicht darum.
Ich flüchte mich vor der Realität in märchenhafte Erzählungen und Mythen von Übermenschen und Superhelden, die in letzter Minute meinen Hintern retten werden.
Das sind Entwürfe einer imaginierten, allenfalls möglichen, aber nichtexistenten Wirklichkeit. Diese Entwürfe waren und sind extrem wirkmächtig, weil sie emotionale Entlastung schaffen. Ich fühle mich darin nicht verantwortlich oder schuldig. Es nährt die Hoffnung, ich hätte noch eine Chance. So löse ich die Probleme (als Spezies) aber nicht.
Ich sehe mich im ständigen Bestreben, das Stadium des Mythos hinter mir zu lassen. Aus dem mythischen Halbdunkel möchte ich in das strahlende Licht der Vernunft treten. Ein ganzes Zeitalter habe ich danach benannt: das Zeitalter der Aufklärung.
Mit größtem Stolz verweise ich auf die jahrtausendealte Tradition menschlicher Denker und Denkerinnen, wobei Denkerinnen selten, nahezu gar nicht, wahrgenommen werden. Die Lexika der Philosophie und der Wissenschaftsgeschichte beschränken sich im Wesentlichen auf männliche Geistesgrößen (Matilda Effekt). Wer denkt an Eunice Newton Foote, die als erste Wissenschaftlerin 1856 einen direkten Zusammenhang zwischen der Kohlenstoffdioxid-Konzentration in der Luft und der Erwärmung der Erdatmosphäre erkannte? Damit identifizierte sie eine wichtige Komponente des Treibhauseffekts. In diesem Zusammenhang fallen mir eher die Veröffentlichungen von John Tyndall (1859) und Svante Arrhenius (1895) ein.
Es ist eine so unglaubliche Verzerrung des angeblich rationalen Denkens, ein durch und durch männlicher Mythos: Ich erzähle unentwegt die irrige Geschichte, dass Männer die besseren Denker, Erfinder, Staatsmänner oder Kriegsherren sind.
Die Erzählungen über die Welt sind männlichen Ursprungs. „Das ist doch in der Natur der Welt so begründet, das ist Naturgesetz“, sage ich, der männliche Homo sapiens sapiens, und schaue meiner Frau beim Kochen und der Kindererziehung zu. Ich nenne das neuerdings Care-Arbeit und gebe dafür keinen Cent aus. Obwohl ich wissen könnte, dass die Zivilisation ohne diese vielfältigen Leistungen von Frauen bei der Betreuung von Kindern und der Pflege von alten Menschen nicht existieren könnte. Das Bruttosozialprodukt, eine pseudowissenschaftliche Nebelkerze, wird unter anderem dadurch bestimmt, wie viele Panzer und Granaten ich herstelle und verkaufe. Die liebevolle Zuwendung einer Mutter oder eines Vaters zu ihren Kindern oder der Großeltern zu ihren Enkeln fließt in die Berechnung nicht ein. Der Tod macht auf dem Börsenparkett eine gute Performance, die Empathie ist nur für Schwächlinge.
Im Gegensatz zum Mythos sehe ich den Logos. Der Logos als vernunftgeleitetes Denksystem sucht mit logischen Schlüssen und Argumenten zu beweisen, was wirklich und wahr ist. Der Logos bedingt den Aufstieg der menschlichen Gattung aus einem archaischen und unvernünftigen Zustand in einen zivilisierten und vernünftigen. Die Lobpreisungen des menschlichen (männlichen) Logos und seiner Wirkungskraft sind Legion.
Homo sapiens sapiens nennt das stolz:
Vom Mythos zum Logos
Aber ist es wirklich so? Habe ich wirklich die Weisheit, gar die doppelte Weisheit, von der ich so schwärme? Die Grenzziehung zwischen Glauben (Mythos) und Wissen (Logos) ist zudem unbewiesen, unbegründet und willkürlich: Ich glaube, zu wissen. Meine Wirklichkeit ist gefühlt, nicht gewusst. Ich kann mich selbst ein Leben lang belügen und meine Lügen für wahr und richtig halten:
Der Mythos vom Logos
Wie komme ich auf diese Idee? Indem ich mich umschaue und meine Beobachtungen mit den Narrativen vergleiche, die darüber verbreitet werden. Ich könnte versuchen, vorurteilsfrei, ohne rosa Brille oder Aluhut, die Widersprüche in den Erzählungen aufzudecken. Aber das ist schwierig und schmerzhaft, letztlich unmöglich, weil es so viele Widersprüche in meiner angeblich omnipotenten Weisheit gibt.
Beim Betrachten der Welt frage ich mich unentwegt: Ist das vernünftig? Ist das der berühmte menschliche Logos meiner Spezies? Trägt der Kaiser wirklich neue Kleider oder ist er in Wirklichkeit nackt und niemand wagt es, das Offensichtliche auszusprechen?
Und mir ist bewusst, dass all dies schon mehr als einmal gedacht, gesagt oder geschrieben wurde. In vielfältiger Form, in Religion, in Philosophie und in naturwissenschaftlichen Gedankengebäuden, habe ich mir in den vergangenen Jahrtausenden bereits Gedanken über das Wesen des Menschseins gemacht. Die gesammelte „Weisheit“ hat mich aber nicht weitergebracht, keinen Zentimeter. (Fischer, 2011).
Genau dieser Gedanke frustriert mich. Ich bewege mich offenbar in einem stetigen Zyklus von Begreifen und Vergessen.
Ich bin wie ein Erkenntnis-Sisyphos. Ich rolle meine Gedankenkugel den Berg hoch, dann verliere ich das Interesse oder den Mut. Die Kraft verlässt mich und ich kann mich nicht mehr konzentrieren. So rollt meine schöne Gedankenkugel wieder in den Nebel der Talsenke, und meine Erkenntnisse sind für mehr oder weniger lange Zeit verloren. Da hilft mir auch kein Wikipedia. Im Gegenteil, das allverfügbare Lexikon macht alles noch schlimmer. Denn ich verlasse mich darauf, jederzeit alles nachschlagen zu können. Und es ist so verführerisch, sich von Zeit- und Konzentrationsvernichtungsmaschinen einlullen zu lassen. Ich verschiebe meine Suche nach der Wahrheit auf morgen, schaue eine neue Staffel auf Netflix oder tauche in die schillernde Welt der Influencer*innen ein. Immer und immer wieder auf morgen, weil ich doch so viel Zeit habe.
Und Tag für Tag aufs Neue bin ich stolz auf meine so einzigartig neuen und revolutionären Ideen. Nur dass ich diese schon vor Jahrhunderten bereits gedacht habe. Jahrtausend für Jahrtausend komme ich so in den wichtigen Fragen eines gelingenden menschlichen Zusammenlebens nicht voran. Es geht also nicht in erster Linie um Faktenwissen. Vor nicht allzu langer Zeit war ich der festen Überzeugung, dass ich bald alles Wissen der Welt zusammengetragen hätte. Mein reger Geist habe alle Geheimnisse der Natur erforscht und in einer einzigen allumfassenden Enzyklopädie zusammengefasst. Und aus diesem allumfassenden Wissen heraus wäre mir nichts mehr unmöglich. Da ich alle Ursachen kenne, wäre mir letztlich die Zukunft bekannt.
Wie stolz war ich bei dieser Vorstellung!
Ernüchtert stelle ich zunehmend fest, dass ich zwar immer mehr weiß, aber proportional dazu auch mein Nichtwissen wächst. Es gibt ganz offenbar eine Grenze des Wissens, die ich nie überschreiten werde. Dahinter liegt die Erkenntnis über die Komplexität und den Sinn meiner Existenz. Sie wird mir immer verborgen bleiben. Darüber sollte ich mir keine Illusionen machen. Es gibt keine Wahrheiten, es gibt nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt die Unschärfe, das Ungewisse, und nur dadurch sind Fortschritt und Evolution möglich.
Gott würfelt.
„Ist es möglich„, fragt Rilke 1910, „dass man trotz Erfindungen und Fortschritt, trotz Kultur, Religion und Weltweisheit an der Oberfläche des Lebens geblieben ist?“ – „Ja, es ist möglich„, lautet seine Antwort. (Rilke, 1910)
Ich verfüge über eine naturwissenschaftlich-technische Intelligenz, die mich in die Lage versetzt, meine Umwelt so umzugestalten (zu deformieren), wie das kein anderes Wesen auf diesem Planeten vermag. Ich verfüge weiterhin über eine schöpferische Fantasie, die es mir erlaubt, meine Handlungen im Geiste vorwegzunehmen, also erst einen Plan zu machen. Und ich bin mit einem unverdrossenen Ehrgeiz ausgestattet. Auch wenn ich tausendmal scheitere, ich versuche es noch einmal. Nicht zuletzt habe ich zwei universale Greifwerkzeuge in meinem Blickfeld, meine beiden Hände. Diese können allerdings nicht nur Kunstwerke schaffen, sondern auch viel Unglück anrichten.
Ich habe fraglos eine große kommunikative Fähigkeit, aber ich stelle weder die richtigen Fragen, noch gebe ich die richtigen Antworten und vor allem: Selbst, wenn ich eine Idee vom richtigen und sinnvollen Handeln habe, dann tue ich es nicht. Die Evolution der Sprache (Deutscher, 2018) ist in meiner Spezies weit fortgeschritten und damit auch die Evolution der Lüge, der Diskriminierung, der Kränkung und des Verrates. Die Evolution der Schrift mündet in die Bürokratie.
Eine richtige und wichtige Frage könnte sein: ‚Ist das, was ich tue, vernünftig?‘ Und zwar nicht nur für heute, sondern auch für zukünftige Menschengenerationen? Denn das ist der entscheidende Punkt: Wenn ich heute die Welt auf den Kopf stelle, was sagen meine Kindeskinder dazu?
Mir erscheint dies als das größte Versagen von Homo sapiens sapiens, mein Versagen.
Ich befinde mich, trotz aller Aufklärung, trotz aller vermeintlicher Vernunft, auf der biologischen Entwicklungsstufe eines Kleinkindes. Dieses ist in blinder Begeisterung über seine wachsenden Kräfte in der Lage, seine Umwelt zu gestalten. Dabei verursacht es leider ein unumkehrbares Chaos. Das Kind bekommt seine Affektsteuerung nicht in den Griff. Wenn in dem Chaos die Stimme der Vernunft zum Aufräumen und Innehalten ruft, wird sie empört zurückgewiesen. Das Bild des verunsicherten kleinen Kindes, das die Welt, die es ängstigt, vergeblich zu kontrollieren versucht, findet sich als Grundmotiv bei Horst-Eberhard Richter im ‚Gotteskomplex‘ (Richter, 1979).
Mein Plan zu den Sternen aufzubrechen, und den Mars zu besiedeln, wirkt wie ein Traumtanz, ein Albtraumtanz. Ich bin nicht in der Lage, auf meinem Heimatplaneten eine funktionierende Biosphere 2 zu errichten, wie soll mir das auf dem Mars gelingen? (Seidler, 2019). Mit anderen Worten: Ich habe zu Hause genug zu tun, fliege aber lieber in die Unendlichkeit. Vermutlich habe ich zu viele Science-Fiction-Filme gesehen. Und natürlich, weil ich gierig bin. Weil wirtschaftliches Wachstum zwanghaft bedeutet (Beckert, 2025), nicht nur die Erde, sondern auch die unendlichen Weiten auszubeuten.
Homo sapiens sapiens war schon immer mit der zerstörerischen Kraft der Wanderheuschrecke unterwegs. Im Vergleich zu mir ist sie ein harmloses Tierchen.
„Dass der Mensch das edelste Geschöpf sei, lässt sich auch schon daraus abnehmen, dass ihm noch kein anderes Geschöpf widersprochen hat“, schrieb der Erfinder der deutschen Aphorismen, Georg Christoph Lichtenberg. Das kann nur Ironie sein.
Ich, Homo sapiens sapiens, halte mich für ein vernünftiges Wesen. Eine gegenteilige Meinung kann ich gar nicht ertragen. Dieses überhebliche Urteil über meine Geisteskraft ist die grandioseste Fehleinschätzung, die meine zivilisatorischen Bemühungen zunichtemachen wird.
Ich rase mit Höchstgeschwindigkeit auf den Abgrund zu, und es kümmert mich nicht, es kümmert wirklich niemanden! Schon gar nicht die Evolution, die hat ganz andere scheitern und verschwinden lassen.
Vielleicht nimmt mich in ferner Zukunft eine Silizium-Intelligenz virtuell oder auch ganz real an die Hand und führt mich geduldig zurück in mein Spielzimmer. Damit ich endlich aufhöre, Chaos zu verbreiten. Nuckel rein und Ruhe ist. Die Matrix lässt grüßen.
Die folgenden Betrachtungen kann wohl jede*r machen. Ich stoße immer wieder auf das gleiche Problem: Wir schaffen es nicht, auch nur ein wenig über unseren Tellerrand zu schauen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich in meinem Kinderstuhl nicht hoch genug sitze. Und es gibt niemanden, der mir eine Sitzerhöhung unterschiebt.
Nicht, dass meine Mitmenschen es nicht schon versucht hätten. Wenn ich Erich Fromm’s „Haben oder Sein“ (Fromm, 1979) lese, und das ist nur ein Beispiel, dann weiß ich nicht, was ich noch sagen und denken soll. Dann weiß ich nicht, und dieses Nichtwissen lässt mich verzweifeln, warum ich immer noch mit voller Windel im Kinderstuhl sitze. Meine Dummheit stinkt zum Himmel.
Machen wir also eine unglaubliche Reise durch das König*innenreich der Unvernunft.